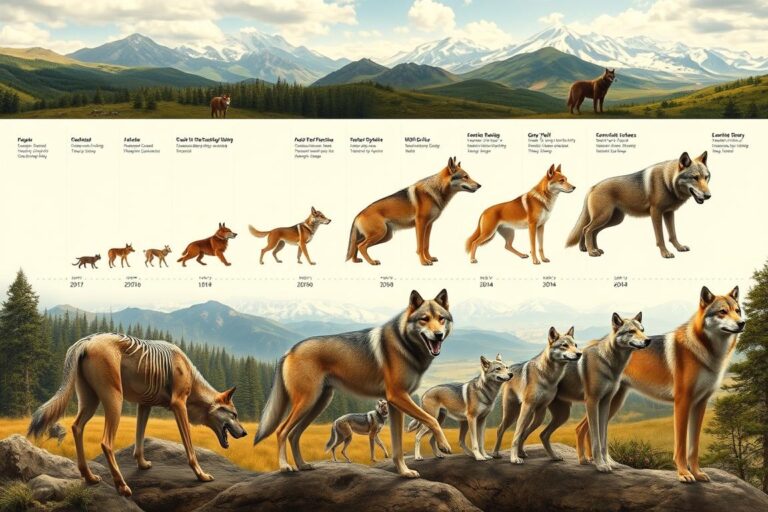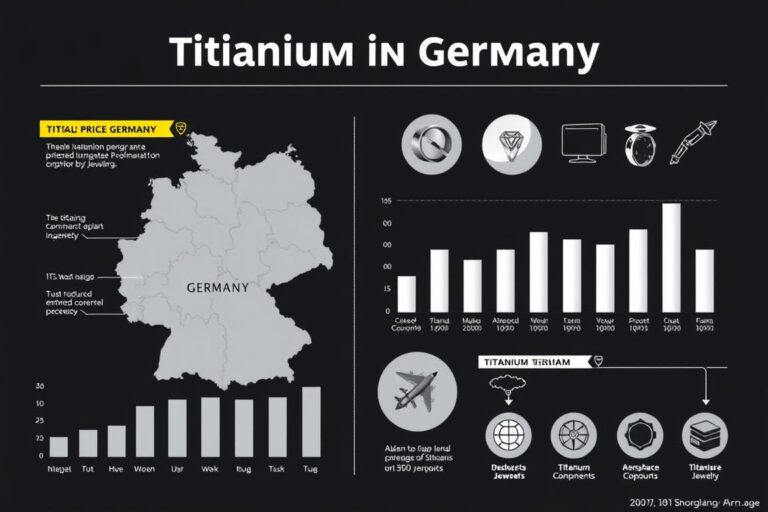Woher kommt der Begriff Nachhaltigkeit?
Wussten Sie, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ bereits 1713 von Hans Carl von Carlowitz in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ erstmals schriftlich formuliert wurde? Ursprünglich im Bereich der Forstwirtschaft verwendet, beschreibt er das Prinzip, nur so viel Holz zu fällen, wie auch nachwachsen kann. Diese frühe Definition hat eine beeindruckend lange Wirkung und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte weiter.
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „nachhaltig“ bezieht sich auf eine „längere Zeit anhaltende[n] Wirkung“. Tatsächlich wurde der Begriff als Substantiv erst 1789 im Werk des Juristen Johann Philipp Frank erwähnt und fand 1915 seine erste lexikalische Erfassung im Rechtschreibduden. Damit ist der Ursprung der Nachhaltigkeit tief in der Geschichte verwurzelt.
Interessanterweise war der Begriff vor 1860 als Substantiv noch nicht erfasst, während das Adjektiv „nachhaltig“ bereits verwendet wurde. Der Brundtland-Bericht von 1987 definierte schließlich nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen erfüllt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden. Diese Definition legte den Grundstein für die heutige Interpretation und Anwendung in verschiedensten Bereichen.
Definition und Bedeutung von Nachhaltigkeit
Die Definition der Nachhaltigkeit umfasst eine breite Palette von Praktiken und Prinzipien, die darauf abzielen, Ressourcen so zu nutzen, dass zukünftige Generationen nicht beeinträchtigt werden. Es ist ein normativer Schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts, der die Zielstellung verfolgt, die Erde dauerhaft als Lebensgrundlage zu erhalten.
Nachhaltigkeit basiert auf dem Prinzip, dass Umweltschutz, Wirtschaftswachstum und soziale Gerechtigkeit gleichberechtigt behandelt werden müssen. Dieses Konzept ist bekannt als das Drei-Säulen-Modell, bei dem ökologische Belange, ökonomische Aspekte und soziale Gerechtigkeit gleichwertig nebeneinanderstehen.
Allgemeine Definition von Nachhaltigkeit
Ein Grundsatz der Nachhaltigkeit ist, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Entwicklung so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Gegenwart entspricht, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Dies wurde im bekannten Brundtland-Bericht von 1987 betont. Die Definition der Nachhaltigkeit geht somit über den bloßen Schutz der Umwelt hinaus und umfasst ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Faktoren.
Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit
Das Drei-Säulen-Modell, auch als Triple Bottom Line bekannt, umfasst die Dimensionen der Nachhaltigkeit: ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit.
- Ökologische Nachhaltigkeit: Bezieht sich auf die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs unterhalb der Regenerationsfähigkeit. Häufig genannt wird das Prinzip, nur so viel Holz zu schlagen, wie nachwachsen kann.
- Ökonomische Nachhaltigkeit: Strebt nach dauerhaftem Wirtschaftswachstum und ökonomischer Sicherheit, wobei die Ressourcen der Erde sinnvoll verwaltet werden sollen, um die aktuelle und zukünftige Prosperität sicherzustellen.
- Soziale Nachhaltigkeit: Zielt darauf ab, soziale Gerechtigkeit zu fördern und die sozialen Bedürfnisse aller Menschen zu berücksichtigen, um ein Gleichgewicht und soziale Stabilität zu erreichen.
Diese drei Dimensionen sind miteinander verknüpft und bilden einen integralen Bestandteil eines umweltgerechten, wirtschaftlich tragfähigen und sozial gerechten Systems.
Die Herkunft des Begriffs Nachhaltigkeit
Die herkunft von nachhaltigkeit ist tief verwurzelt in der Geschichte und den Arbeiten von Hans Carl von Carlowitz. Das Konzept der Nachhaltigkeit, wie wir es heute verstehen, wurde erstmals im Jahr 1713 formuliert und hat seitdem weite Verbreitung und Anwendung gefunden.
Erste schriftliche Erwähnung durch Hans Carl von Carlowitz
Hans Carl von Carlowitz, ein deutscher Oberberghauptmann, prägte den Begriff „Nachhaltigkeit“ in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“, veröffentlicht im Jahr 1713. In dieser bahnbrechenden Arbeit forderte er eine nachhaltige Forstwirtschaft, die darauf abzielt, nur so viel Holz zu schlagen, wie auf natürliche Weise wieder nachwachsen kann. Durch diese Prinzipien legte Carlowitz den Grundstein für ein Umdenken im Umgang mit natürlichen Ressourcen, das bis heute in der Forstwirtschaft relevant ist.
Die Bedeutung in der Forstwirtschaft
Im Verlauf der letzten 300 Jahre hat die nachhaltigkeit in der forstwirtschaft eine zentral Bedeutung erlangt. Die Prinzipien von Carlowitz wurden in der deutschen Forstgesetzgebung verankert und sind heute im Bundeswaldgesetz sowie in den Waldgesetzen der Bundesländer festgeschrieben. Zudem hat die deutsche Regierung seit 2013 das Holzhandels-Sicherungs-Gesetz (HolzSiG) zur Umsetzung der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) eingeführt, um illegalen Holzeinschlag zu verhindern.
Ein weiteres bedeutendes Beispiel für die herkunft von nachhaltigkeit ist die neue EU-Verordnung gegen Entwaldung, die ab Ende 2024 in Kraft tritt. Diese wird sicherstellen, dass relevante Rohmaterialien und Produkte, wie Holz, Soja, Palmöl, Rindfleisch, Kaffee, Kakao, und Gummi, frei von Entwaldung und Walddegradation sind. Diese Maßnahmen zeigen die wachsende Bedeutung des nachhaltigkeitskonzeptes in der modernen Forstwirtschaft und darüber hinaus.
Die Entwicklung des Nachhaltigkeitskonzepts
Das Konzept der Nachhaltigkeit hat sich seit seiner Einführung dramatisch weiterentwickelt. Während es ursprünglich auf die Forstwirtschaft beschränkt war, umfasst es heute globale, umweltpolitische und soziale Aspekte. Die Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs wurde durch internationale Konferenzen und Organisationen wie die UNESCO vorangetrieben.
Einen wichtigen Schritt stellte die Agenda 21 dar, die bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro verabschiedet wurde. Diese enthält Handlungsempfehlungen für die nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen. Der Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Kommission) von 1987 definiert nachhaltige Entwicklung als eine, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden.

Im September 2015 wurde die Agenda 2030 von der internationalen Staatengemeinschaft verabschiedet. Diese definiert 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung und strebt eine Welt bis 2050 an, in der wirtschaftlicher Wohlstand für alle mit sozialem Zusammenhalt und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einhergeht.
„Die Europäische Union formulierte 2001 eine Europäische Strategie für nachhaltige Entwicklung (ENS) und im Januar 2019 legte die EU-Kommission ein Reflexionspapier über ein nachhaltiges Europa bis 2030 vor.“
Seit 2017 gibt es ein EU-SDG-Indikatorenset mit rund 100 Indikatoren zur Messung der Fortschritte bei der Umsetzung der SDGs in den EU-Mitgliedstaaten. In den letzten Jahren musste die Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs in den Konzepten wie das der nachhaltigen Entwicklung eingebettet werden, um die Interessen zukünftiger Generationen zu betonen.
Heute beinhalten globale Nachhaltigkeitsstrategien breite Konzepte wie den European Green Deal und der Wirtschaft für die Menschen. Jährliche Berichte und Konferenzen, wie die Europäische Nachhaltigkeitswoche, fördern das Bewusstsein und unterstützen die Umsetzung.
Moderne Nutzung und Interpretation
In der modernen Gesellschaft nimmt das Konzept der modernen Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle ein. Der Begriff „sustainable“ wurde erstmals 1972 im Bericht des Club of Rome in seiner modernen Bedeutung verwendet und hat seither zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nachhaltigkeit umfasst heutzutage nicht nur Umweltpolitik, sondern durchdringt viele Wirtschaftssektoren und tägliche Handlungen.
Nachhaltigkeit in der heutigen Umweltpolitik
In der heutigen Umweltpolitik wird stark auf nachhaltiges Wirtschaften Wert gelegt. Die UNCED-Konferenz von 1992 in Rio de Janeiro war ein Meilenstein, aus dem fünf zentrale Erklärungen hervorgingen, darunter die Deklaration von Rio. Diese Deklaration griff den Gedanken der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit auf und beeinflusste die deutsche Umweltpolitik maßgeblich. Deutschland entwickelte 2002 seine erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die bis heute fortgeführt wird.
Beispiele für nachhaltiges Handeln in verschiedenen Sektoren
Nachhaltiges Handeln zeigt sich in verschiedenen Sektoren auf vielfältige Weise. Ein Beispiel ist die nachhaltige Stadtentwicklung, die darauf abzielt, Städte umweltfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Auch erneuerbare Energietechnologien spielen eine große Rolle, wie Windkraft- und Solaranlagen, die als Alternativen zu fossilen Brennstoffen dienen. Darüber hinaus investieren immer mehr Unternehmen in sozialverantwortliche Produktionspraktiken, um die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Geschäftsprozesse zu minimieren. Insgesamt zeigt sich, dass nachhaltiges Handeln in vielen Bereichen unseres Lebens Einzug hält und auf diese Weise die moderne Nachhaltigkeit effektiv gefördert wird.
Die Rolle der UNO und internationaler Konferenzen
Die Vereinten Nationen spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Internationale Konferenzen wie die Stockholmer Konferenz 1972 und die Arbeiten der Brundtland-Kommission haben das Verständnis und die Bedeutung von Nachhaltigkeit maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.
Stockholmer Konferenz 1972
Die Stockholmer Konferenz 1972 markierte einen Meilenstein in der internationalen Umweltpolitik. Diese Veranstaltung legte den Grundstein für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP). Die Konferenz war der erste große Versuch, globale Umweltprobleme auf politischer Ebene anzugehen und ermöglichte es, Umweltschutz auf die internationale Tagesordnung zu setzen.
Die Brundtland-Kommission und der Brundtland-Bericht
Die Brundtland-Kommission, offiziell als Weltkommission für Umwelt und Entwicklung bekannt, wurde 1983 von den Vereinten Nationen eingerichtet. Unter der Leitung von Gro Harlem Brundtland veröffentlichte die Kommission 1987 den wegweisenden Brundtland-Bericht. Dieser Bericht definierte nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
Der Brundtland-Bericht wurde zur grundlegenden Referenz für nachfolgende UNO Nachhaltigkeitskonferenzen und legte den Fokus auf die Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten der Entwicklung. Die in diesem Bericht formulierten Leitprinzipien beeinflussten maßgeblich die Agenda 21 und die Ergebnisse der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro.